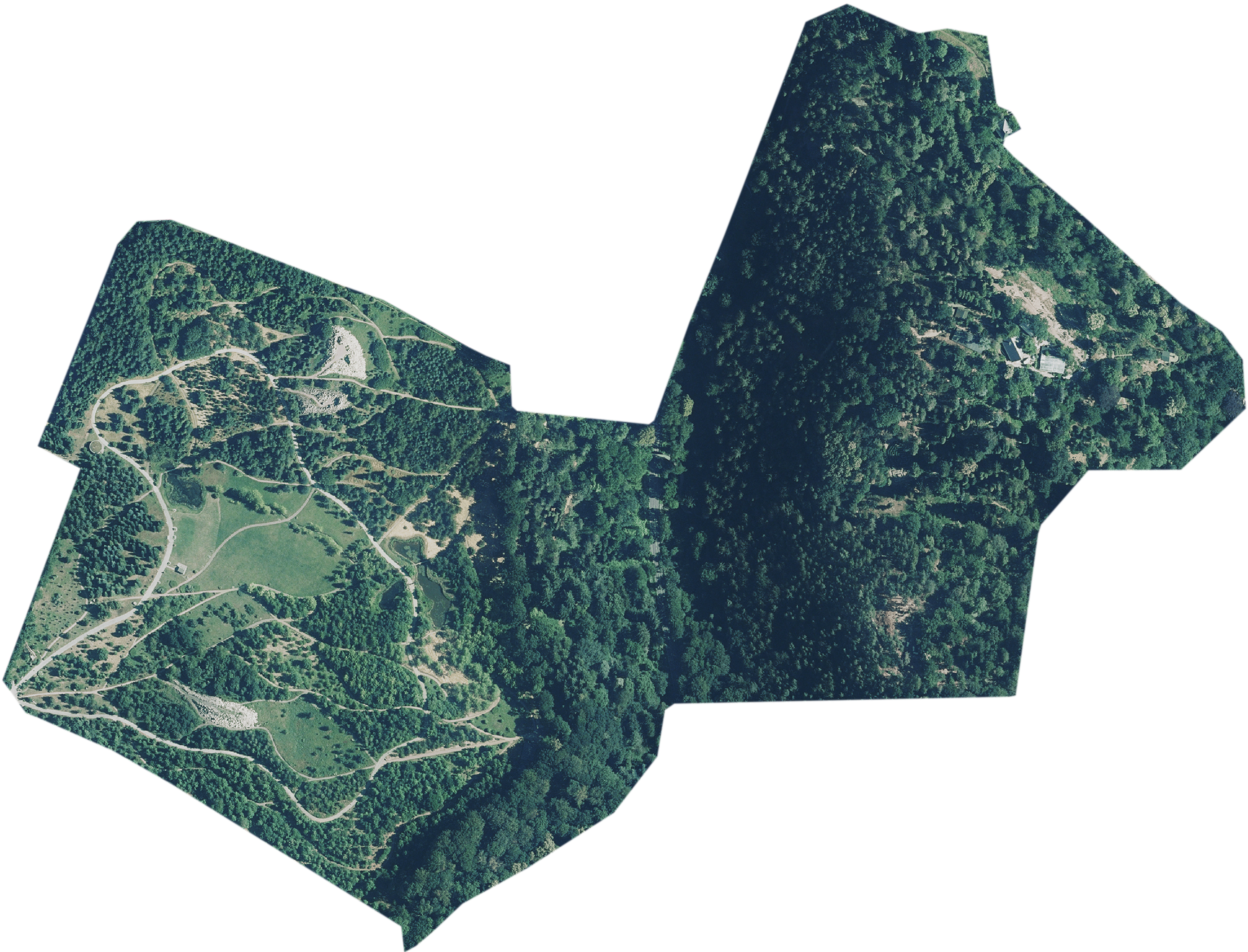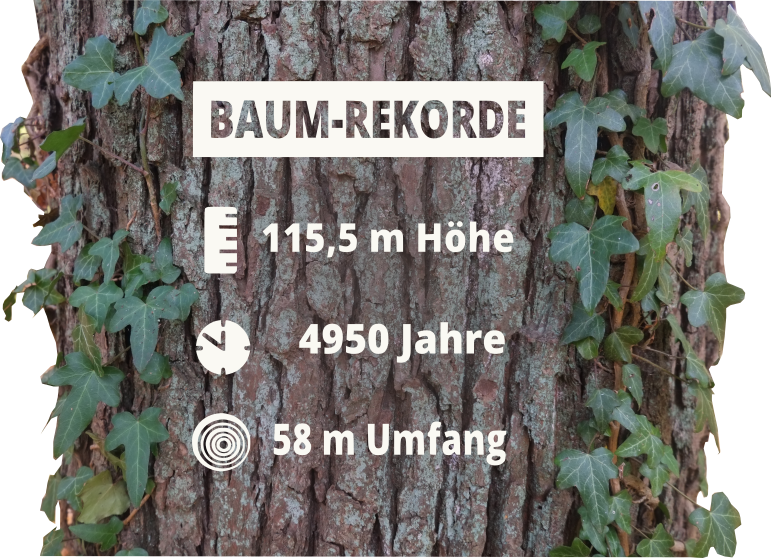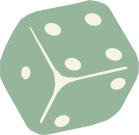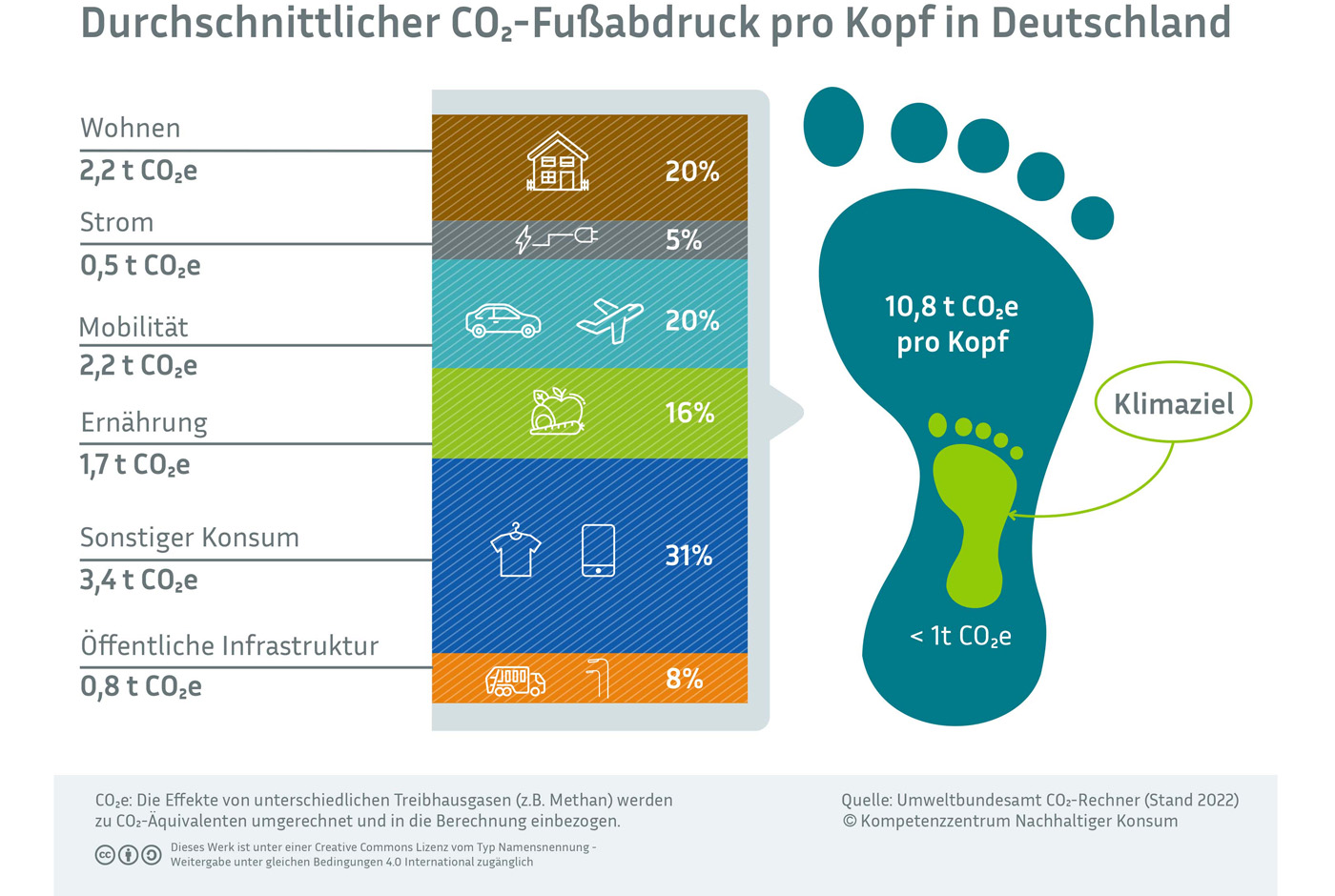Die Wurzel einer Pflanze ist der unterirdische Teil, der die Pflanze im Boden verankert, Wasser und Nährstoffe aufnimmt und Fotosynthese-Produkte speichert (z. B. Kartoffeln, Möhre, Zuckerrübe). Es gibt verschiedene Wurzeltypen:
- Flachwurzeln
Bei diesem Wurzelsystem gibt es mehrere starke, waagerecht wachsende Hauptwurzeln, von denen kleinere Senkerwurzeln nach unten abzweigen. Es entstehen breite, oberflächennahe Wurzelteller. Dieses Wurzelsystem hat Vorteile auf sehr nassen oder verdichteten Böden, ist allerdings auch sehr windwurfgefärdet. Beispiele für Bäume mit Flachwurzeln sind Gemeine Esche, Fichte, Zitter-Pappel und Eberesche. - Herzwurzeln
Dieser Wurzeltyp hat mehrere schräg wachsende dominante Wurzeln, von denen jeweils mehrere kleinere Wurzeln abzweigen. So entsteht eine Form, die der eines menschlichen Herzens ähnelt. Beispiele für Bäume mit Herzwurzel sind Ahorne, Birken, Hainbuche, Rot-Buche, Schwarz-Erle, Europäische Lärche, Douglasie und Linden. - Pfahlwurzeln
Diese Wurzeln haben eine dicke Hauptwurzel, die gerade nach unten geht und von der kleinere Wurzeln abzweigen. Dieses Wurzelsystem kann sehr tief in den Boden vordringen und hat somit Vorteile an trockenen Standorten, in Felsspalten und bei Bodenverdichtung. Beispiele für Bäume mit Pfahlwurzel sind Weiß-Tanne, Wald-Kiefer, Stiel-Eiche. [3]